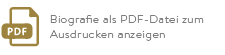HIER LERNTE
OTMAR ‘OTTO‘ SILBERSTEIN
- 1920
FLUCHT 1939
ENGLAND
INTERNIERT 1940
AUSTRALIEN
AUSTRALIAN ARMY 1942
Verbundene Gedenksteine
Fritz Kraus
Fritz Kreisel
Georg Kreisel
Herbert Kandel
Ernst Rosner
Walter Berger
Otmar Silberstein wurde am 16. August 1920 in Graz als der Sohn des Kaufmannes Markus Silberstein (geb. am 26. Mai 1880 in Kielce im heutigen Polen) und dessen Frau Salka Silberstein (geb. Scheindel bzw. Teitelbaum, 1893 im heutigen Polen) geboren. Seine ältere Schwester Amalie (Mela) wurde am 5. Dezember 1918 geboren. Die Familie wohnte bis zur Vertreibung in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 3 im Grazer Bezirk Jakomini. Außerdem lebte in Graz noch die Familie seines Onkels Robert Silberstein (geb. 9. September 1894), die einen ihrer Söhne ebenfalls Otmar nannten. Otmar Silberstein besuchte ab dem Schuljahr 1930/31 das Lichtenfelsgymnasium, wo er im Mai 1938 noch maturieren konnte.
Sein Vater, Markus Silberstein, betrieb in der Mariahilferstraße 3 das „Modehaus Markus Silberstein“ und war Betriebsleiter des „Warenhaus Rekord“ in der Sackstraße 16. Beide Geschäfte wurden Ende Mai 1938 unter kommissarische Verwaltung gestellt. Das Geschäft in der Mariahilferstraße wurde von Wilhelm Wogrinetz und das in der Sackstraße von Alois Putzel verwaltet. Nachdem sich Markus Silberstein geweigert hatte, die Schlüssel für seine Geschäfte abzugeben, wurde er am 9. Juni 1938 festgenommen und für mehrere Wochen in Schutzhaft genommen. Am 17. Juni wurde dann sein Geschäft in der Neutorgasse an den Nationalsozialisten Walter Egger zwangsverkauft.
Während der Novemberpogrome wurde Markus Silberstein erneut verhaftet und mit rund 300 weiteren Grazer Juden ins KZ Dachau deportiert. Im Juli 1939 konnten er und seine Frau schließlich nach Italien flüchten. Von dort gelang ihnen der Umzug in die USA, wo sie fortan unter den Namen Max und Sara Silverstein lebten. Otmar Silbersteins Schwester Amalie übersiedelte bereits kurz nach dem „Anschluss” im April 1938 mit ihrem aus Rădăuți (Radauz) stammenden Ehemann Ernst Rachmuth in dessen Heimat nach Rumänien. Ernst Rachmuth wurde dort im Oktober 1941 im Zuge von Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden verhaftet und 1942 erschossen. Das weitere Schicksal von Amalie ist nicht bekannt, sie gilt als vermisst.
Otmar Silberstein konnte im November 1938 untertauchen und entging so der Verhaftung und Deportation. Ihm gelang mit Hilfe der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien im Jahr 1939 die Flucht nach England. Um an die nötigen Ausreisepapiere zu gelangen und die Dringlichkeit seiner Situation zu unterstreichen, legte er Postkarten vor, die sein jüngerer Namensvetter (der Sohn von Robert Silberstein) aus dem KZ in Dachau an seine Eltern geschickt hatte. In England kam er in das Anfang des Jahres 1939 eröffnete Kitchener Camp im Nordosten der englischen Grafschaft Kent. Das ehemalige britische Armeelager aus dem 1. Weltkrieg wurde von Februar 1939 bis Mitte 1940 als Durchgangslager für jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich genutzt.
Im Juli 1940 wurde er schließlich als „Enemy Alien“ („Ausländer aus Feindländern“) verhaftet und am 10. Juli 1940 auf der HMT Dunera nach Australien deportiert. Die Bedingungen auf dem Schiff waren derart katastrophal, dass er bei der Überfahrt schwer erkrankte und bei der Ankunft in Australien sofort ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Von Sydney kam er zuerst ins 700 km entfernte Wüstencamp Hay und später ins 250 km südlichere Tatura Camp. Dort meldet er sich als Freiwilliger zum Militärdienst in der Australischen Armee und wurde am 8. April 1942 Mitglied der 8th Employment Company. Diese Arbeitskompagnie der Australian Army wurde hauptsächlich aus internierten Männern von der Dunera gebildet und für manuelle Arbeiten wie Instandhaltung, Bau oder Logistik herangezogen. Während seiner Internierung und seiner Zeit im Militär spielte er Violine in den jeweiligen Lager-Orchestern.
Nach dem Krieg erhielt er im April 1948 die britische Staatsbürgerschaft, zog aber Ende der 1940er Jahre in die Vereinigten Staaten, wo es ein Wiedersehen mit seinen Eltern und anderen Verwandten gab. Er änderte seinen Namen in Otto Silverstein und arbeitete in der Folge als Musiker. Bis 1976 spielte er die Violine beim Kansas City Symphony Orchestra. Otto Silverstein verstarb im Juni 1986 alleinstehend in Florida.
Verfasst von: Mag. Klaus Schinnerl, unter Mitarbeit von Markus Schreiber und Alexander Mohr (BG/BRG Lichtenfels)
Quellen:
Schularchiv BG/BRG Lichtenfels: Klassenkatalog Schuljahr 1937/38, Maturaprotokolle Haupttermin 1938
Geni.com: https://www.geni.com/people/Otto-Otmar-Silverstein-Silberstein/6000000097584759836?through=6000000097584728821 [letzter Zugriff Juni 2025]
Verein für Gedenkkultur Graz: https://www.stolpersteine-graz.at/stolpersteine/silberstein-otmar-otto/ [letzter Zugriff Juni 2025]
Heimo Halbrainer, Vom “Modehaus Markus Silberstein” zum “Volksbekleidungshaus” (Mariahilferstraße 3) In: Heimo Halbrainer / Gerald Lamprecht (Hg.): Jüdischer Lend. Eine Spurensuche. CLIO: Graz 2024, S. 143-150.
National Archives of Australia: Citizen Military Forces Personnel Dossiers (NAA: B884, V377623), Alien registration documents (NAA: B78, 1948/SILBERSTEIN O), Prisoner of War/Internee: Silberstein, Otmar (NAA: MP1103/1, E40656)